Tucholsky schreibt einen verspielten Roman über Schweden. Der Roman ist ein Ferien-Roman, den er während seiner Ferien auch niederschrieb. Man bekommt den Eindruck, daß er viele andere Nichtferien-Romane schrieb – ganz im Gegenteil – sein Ferien-Roman war sein Einziger. Der Roman heißt Schloß Gripsholm – eine Sommergeschichte. Im Roman fährt er nach Schweden mit seiner Freundin, die er Prinzessin nennt. Sie nennt ihn oft Daddy, manchmal Fritz, gelegentlich Peter, je nach Laune. Sie ist eine Sekretärin (wie alle Prinzessinnen) und sie heißt Lydia. An ihr liebt er vor allem ihre tiefe Plattdeutsch sprechende Alt Stimme. Sie hat auch ein außerordentliches gutes Timing im psychologischen Sinn – vor allem beim Blind-Spucken im leeren Zugabteil. Im Schlaf sieht sie nicht dumm aus – was leicht möglich wäre – männlich nüchtern ist sie wenn sie ihm sagt – „Wir müssen alle sterben, Du früher, ich später.“ Wenn „die Prinzessin“ mal ihre Handtasche nicht findet – fragt sie „Hast Du den Dackel gesehen?“
Sie singen auch gemeinsam Reise-Lieder auf der Reise. Es ist alles so beschwingt, lustig, großstädtisch – eine überdurchschnittliche Büroliebschaft. Obgleich die Schweden Reise ‚ordentlich’ geplante Ferien waren (die Reisekasse hatten sie sechs Monate lang zusammen gespart) – haftet an der Erzählung das unverkennbare Gefühl des ‚nie wieder’ – die großstädtische Stimmung einer Oase auf kurze Zeit. Ganz ausgeprägt ist solche flüchtige halb-tiefe Wehmut in Tucholskys Gedicht von der täglichen Fahrt zur Arbeit in der Großstadt:
Augen in der Groß-Stadt
„Wenn du zur Arbeit gehst
am frühen Morgen,
Wenn du am Bahnhof stehst
mit deinen Sorgen
da zeigt die Stadt
dir Asphalt glatt
im Menschentrichter
Millionen Gesichter:
Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick,
die Braue, Pupillen, die Lider –
Was war das? Vielleicht dein Lebensglück...
vorbei, verweht, nie wieder.“
Tucholsky verzaubert mit seinem bitter-süßen vereitelten Liebesglück in der Großstadt, Walser dagegen denkt daran wie er einmal im Auto an einer Frau vorüber flog, die er möglicherweise (wenigstens in der Einbildung) in der Provinzstadt im Stich gelassen hatte.
Jenes kurzlebige Fast-Glück, wobei das eigentliche Glück im Rausch des Verpaßtseins liegt – das beschreiben gewisse mittel und -osteuropäische Artisten am besten, so auch die Comedian Harmonists in ihren vielen Liedern – wie zum Beispiel In der Bar zum Krokodil oder Du bist nicht die Erste. Ganze Welten von untergegangenen, untergetauchten Sentimenten gehen dahin – so veraltet wie der Gebrauch des Tachistoskops für die psychologische Abrichtung.
Alles mag schnell vorbeigehen – die Liebe wie die Verkehrsmittel – aber das Organische bleibt langsam – die Verdauung ist nichts Eiliges – außer wenn ‚die Liebe wie Sekt ins Blut’ geht. So bewundert Lydia die Art wie ihr Freund „frißt“ – „(...) so viel und so schnell“.
„ „Lydia“, sagte ich, „Wir können auch im Speisewagen essen, der Zug hat einen.“ – „Nein!“, sagte sie. „Im Speisewagen werden die Kellner immer von der Geschwindigkeit des Zuges angesteckt, und es geht alles so furchtbar eilig – ich habe aber einen langsamen Magen...“ “ Ein seltener wahrer Satz der Weltliteratur. Als Vor-Verdauungsgespräch.
„ „Lydia“, sagte ich, „Wir können auch im Speisewagen essen, der Zug hat einen.“ – „Nein!“, sagte sie. „Im Speisewagen werden die Kellner immer von der Geschwindigkeit des Zuges angesteckt, und es geht alles so furchtbar eilig – ich habe aber einen langsamen Magen...“ “ Ein seltener wahrer Satz der Weltliteratur. Als Vor-Verdauungsgespräch.
Tucholskys Großstadt Elegie für das nur knapp aber als mögliches imaginiertes Liebesglück Gesehene, verkommt zu etwas ganz ordinärem im Londoner Schund-Blatt „Metro“, was man umsonst am vorstädtischen Bahnsteig mitnimmt. Am Abend fliegen die zerlesenen Fetzen in der verbrauchten Luft des Zugabteils herum.
Die Zeitung nimmt Suchanzeigen auf von jenen die sich in Personen verlieben, die ihnen im Bus, Zug oder Underground nur kurz aufgefallen sind. Oft sind es Personen die sich sowieso regelmäßig sehen müssen – weil sie beide dasselbe ‚commute’ haben. Sogar Kartenverkäuferinnen werden als Göttinnen verehrt. Sie sind aber eher stationär. So schrumpft die riesige Tombola der Großstadt zu etwas berechenbarem, reizlosem zusammen. Die verlorene Zeit der Arbeitsfahrt soll wenigstens noch für die Liebes-Ökonomie rentabel gemacht werden.
Später verlegte Tucholsky seinen Wohnort ganz nach Schweden, als er, wie Heine, zu Deutschland auf Distanz ging.
Dort im Ferien-Roman Land nahm er sich das Leben. Schloß Gripsholm verwandelte sich letztendlich in Rosmersholm.
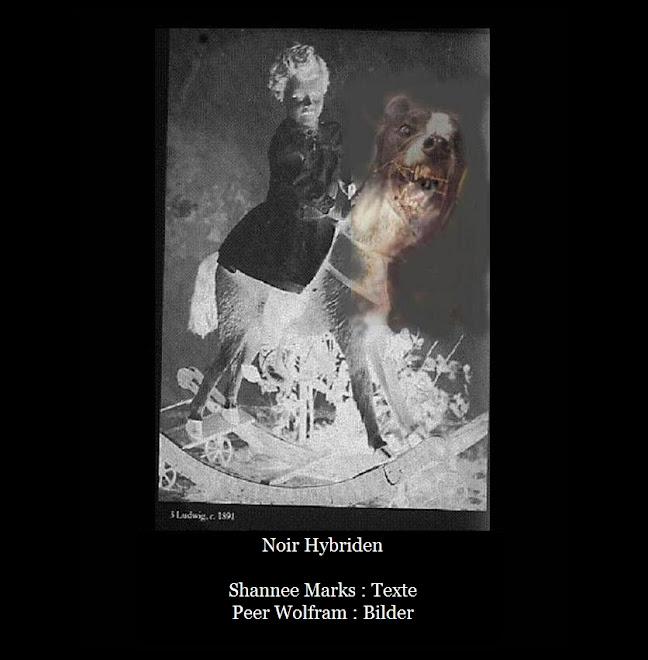
.jpg)
+.jpg)
+.jpg)


















.jpg)







